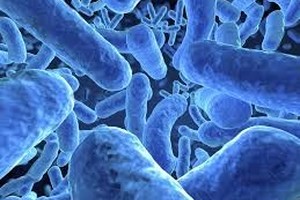
Mikroben lassen sich genetisch so verändern, dass sie im menschlichen Verdauungssystem Wirkstoffe gegen Krankheiten ausschütten. Noch allerdings werden sie meist von ihren natürlichen Verwandten verdrängt.
Genetisch manipulierte Bakterien können dafür sorgen, dass Mäuse trotz eines überreichlichen Nahrungsangebots nicht zu viel essen. Die vorteilhafte Wirkung der Bakterien hält etwa vier bis sechs Wochen an. Das spricht dafür, dass sie sich eine Zeitlang im Magen einnisten.
Als Erstes testete Davies das Konzept bei Fettleibigkeit. Dazu arbeitet seine Gruppe mit einem Stamm von E. coli, der in Europa als verdauungsförderndes Probiotikum verschrieben wird. Die Forscher veränderten diese Bakterien so, dass sie einen appetithemmenden Wirkstoff produzieren, der normalerweise vom Darm als Reaktion auf Nahrungszufuhr abgesondert wird und ein Völlegefühl auslöst; manche Menschen (und Mäuse) produzieren selbst nicht genug davon. „Sie essen zu viel, weil sie kein ‚voll’-Signal bekommen“, erklärt Davies. Andere Forscher versuchen auf andere Weise, diesen Wirkstoff oder niedermolekulare Medikamente mit ähnlicher Wirkung zu verabreichen, unter anderem über Injektionen in den Bauch.
Die Vanderbilt-Forscher gaben ihre Bakterien in Wasser, das einige Mäuse mit einer fettreichen Ernährung bekamen. Die so behandelten Tiere legten 15 Prozent weniger Gewicht zu als diejenigen mit derselben Ernährung, aber ohne die Bakterien. Details seiner Studie präsentierte Davies im März beim Frühjahrstreffen der American Chemical Society.
Charles Elson, ein Gastroenterologe an der Medical School der University of Alabama, bezeichnet den Einsatz der so genannten Designer-Probiotika als viel versprechende Idee. Allerdings schränkt er ein: Es kann enorm schwierig sein, therapeutische Bakterien zu schaffen, die eine Population im menschlichen Darm bilden. „Die dort ansässigen Organismen werden sie bekämpfen“, erklärt er. Dauerhaft könne die Methode deshalb nur funktionieren, wenn die manipulierten Bakterien im Darm nicht auf Konkurrenz von natürlichen Mikroorganismen stoßen.
Außerdem gibt es Risiken. Für gesunde Personen könnte es zum Beispiel gefährlich sein, wenn sie versehentlich appetithemmende Mikroben aufnehmen.
Wie Davies erklärt, arbeitet er vor klinischen Studien noch an einem Mechanismus, der solche Probleme entschärft. Eine Möglichkeit könnte sein, Gene zu eliminieren, die E. colidabei helfen, außerhalb des Darms zu überleben. Eine andere Möglichkeit wäre, einen genetischen „Todesschalter“ hinzuzufügen, auszulösen von einem Wirkstoff, der für menschliches Gewebe sowie das natürliche Mikrobiom unschädlich ist.
Sicherheitsbedenken sind jedoch nicht das Einzige, was Mikrobiom-Therapien aufhält, sagt Andrew Patterson, ein Toxikologe an der Pennsylvania State University, der sich mit bakteriellen Interaktionen im Darm beschäftigt. Die größte Herausforderung liegt nach seiner Darstellung in unserem noch unzureichenden Wissen über diese Mikroben.
In breit angelegten Gen-Sequenzierungsprojekten, unter anderem im Rahmen des mit 200 Millionen Dollar finanzierten Human Microbiome Project der National Institutes of Health in den USA, wird derzeit daran gearbeitet, die Mitglieder von gesunden und kranken Mikrobiomen zu identifizieren. Doch das ist erst der Anfang. Und er ist schwierig, denn die meisten Mikroben, die in und auf dem Körper leben, wachsen in einer künstlichen Laborumgebung nicht.
Die Fettleibigkeitsforschung von Davies ist ein früher Ausblick auf das, was möglich sein wird, wenn wir das Mikrobiom besser verstehen, sagt Timothy Lu, ein Forscher im Bereich synthetischer Biologie am MIT. Fortgeschrittenere Werkzeuge für genetische Veränderungen werden weitere Möglichkeiten bringen, sagt er voraus.
(Katherine Bourzac)
http://www.heise.de/tr/artikel/Genmanipulierte-Bakterien-gegen-Fettleibigkeit-2612301.html
